Erklärung zur Aufklärung
Was treibt die Aufrüstung und globale Konflikte wirklich an? Zwei revolutionäre Denker lieferten dafür unterschiedliche, aber faszinierend ergänzende Analysen.
Karl Marx sah den Motor des Krieges im Kapitalismus selbst. Ein System, das ständig nach neuen Märkten, Rohstoffen und Profiten strebt, erzeugt Konkurrenz und Imperialismus. Aufrüstung wird dabei zu einem lukrativen Geschäft und einem Mittel zur Durchsetzung von Machtinteressen.
Silvio Gesell aber blickte tiefer. Er sah den Treibstoff dieses Motors in einer fundamentalen Schwachstelle: unserem Geldsystem. Die Möglichkeit, Geld zu horten und Zinsen zu verlangen, erzeugt einen unnatürlichen Wachstumsdruck. Um diesem Druck nachzukommen, werden künstlich Märkte geschaffen – oft durch Kriege und Zerstörung.
Vereinfacht gesagt: Gesells Analyse des Geldsystems erklärt, warum der Motor (Marx’ Kapitalismus) überhaupt erst so unkontrolliert und aggressiv läuft.
Der Motor des Krieges
Karl Marx betrachtete Krieg nicht als eine Abweichung oder einen Fehler, sondern als eine mögliche und logische Konsequenz der kapitalistischen Produktionsweise. Seine Analyse setzt bei den fundamentalen Triebkräften des Systems an: dem unaufhörlichen Zwang zur Akkumulation von Kapital und der Suche nach Profit.
Der innere Widerspruch des Kapitalismus:
Das kapitalistische System strebt nach ständigem Wachstum. Es muss produzieren, um zu verkaufen und wieder zu investieren. Wenn die Märkte im Inland gesättigt sind oder der Profit durch Konkurrenz sinkt, entstehen Krisen.
Imperialismus als Ventil:
Um diese Krisen zu überwinden, wendet sich das Kapital nach außen. Der Imperialismus ist in dieser Analyse das Ventil, durch das sich die Spannungen des Systems entladen. Durch die Expansion in neue Gebiete werden neue Märkte erschlossen, billige Rohstoffe gesichert und die Konkurrenz verdrängt. Dieser Prozess führt zwangsläufig zu einem Konkurrenzkampf zwischen den Nationen, der sich oft in militärischer Aufrüstung und schließlich in Krieg entlädt.
Militarismus als Selbstzweck:
Marx’ Weggefährte Friedrich Engels ergänzte diese Sichtweise, indem er betonte, dass der Militarismus auch zu einem Selbstzweck werden kann. Die Rüstungsindustrie, einmal etabliert, hat ein Eigeninteresse an der Aufrechterhaltung der Spannungen, da sie lukrative Aufträge generiert und Arbeitsplätze sichert. Die Armee selbst wird zu einer mächtigen Institution, die politisch Einfluss nimmt und Kriege fördert, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen.
Marx’ Analyse bietet somit eine makroökonomische, systemische Erklärung für Krieg. Der Krieg ist ein brutaler Ausdruck der inneren, nicht gelösten Konflikte des Kapitalismus.
Der Treibstoff des Motors Krieg
Silvio Gesell, ein fast vergessener Außenseiter der Ökonomie, setzte seine Analyse an einem ganz anderen Punkt an: nicht bei der Produktion, sondern beim Medium des Austauschs – dem Geld. Für ihn war das Geldsystem in seiner heutigen Form ein grundlegender Fehler, der die Aufrüstung und den Krieg direkt fördert.
Die Überlegenheit des Geldes:
Gesell argumentierte, dass Geld, im Gegensatz zu allen anderen Gütern (die verderben, veralten oder Lagerkosten verursachen), einen unfairen Vorteil hat: Es kann gehortet werden, ohne an Wert zu verlieren. Diese Eigenschaft in Kombination mit dem Zins schafft einen unaufhaltsamen Druck.
Zinszwang und Stagnation:
Der Zins auf Geld verlangt nach einem konstanten, exponentiellen Wachstum der Realwirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht schnell genug wächst, um die Zinsen auf das gehortete Kapital zu bedienen, kommt es zu Stagnation. Kapital steht nutzlos herum, Investitionen bleiben aus, und die Menschen werden arbeitslos.
Krieg als künstliche Lösung:
Aus Gesells Sicht ist Krieg die destruktive, aber wirtschaftlich “notwendige” Konsequenz dieser Stagnation. Krieg ermöglicht es dem stagnierenden System, sich selbst zu “rebooten”. Durch die Massenproduktion von Kriegsgütern und die Zerstörung von Vermögen werden massive Nachfragen geschaffen, die das gehortete Kapital wieder in Umlauf bringen und die Wirtschaft ankurbeln. Krieg wird so zu einem staatlich geförderten Stimulusprogramm, das die Zins- und Hortungslogik bedient, wo normale Märkte versagen.
Gesells Analyse bietet eine monetäre Erklärung, die eine tiefere, mechanistische Ursache für das von Marx beschriebene Phänomen liefert.
Die Synthese: Eine tiefere Betrachtung der Zusammenhänge
Obwohl Marx und Gesell aus unterschiedlichen Welten stammten, ergänzen sich ihre Analysen zu einer komplexeren und umfassenderen Theorie. Man kann sie als zwei Ebenen derselben Kausalität betrachten:
Die Profitlogik, der Imperialismus und die geopolitische Konkurrenz, die Marx beschrieb, sind der sichtbare Motor des Krieges. Es ist das, was wir auf der globalen Bühne beobachten.
Der Zins und die Hortung, die Gesell analysierte, sind der Treibstoff und der Druck, der diesen Motor erst zum Laufen und überhitzen bringt. Sie schaffen einen fundamentalen, inneren Druck auf das gesamte System, ständig zu expandieren und Gewinne zu erzielen – selbst auf zerstörerische Weise.
In dieser Synthese ist der Krieg nicht nur ein Kampf um Ressourcen (Marx), sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die aus einer systemischen Störung des Geldflusses resultiert (Gesell). Der Kampf um neue Märkte (Marx) wird nicht nur durch die bloße Gier nach Reichtum getrieben, sondern durch den existenziellen Zwang, Anlagemöglichkeiten für das stetig wachsende, zinsgetriebene Kapital zu finden (Gesell).
Beide Analysen zusammen ergeben ein nuancierteres Bild: Sie zeigen, dass die Motivation für Krieg sowohl in den Produktionsverhältnissen als auch in der grundlegenden Struktur des Geldes verankert sein könnte.
Man kann also sagen dass die Profitlogik, Imperialismus und “Militarismus als Selbstzweck” zwar auch andere Ursachen haben kann, aber die “Hortungsfunktion des Geldes” und der daraus resultierende “Zins und Akkumulationszwang” können eine tiefere Ursache und Verstärkung sein.

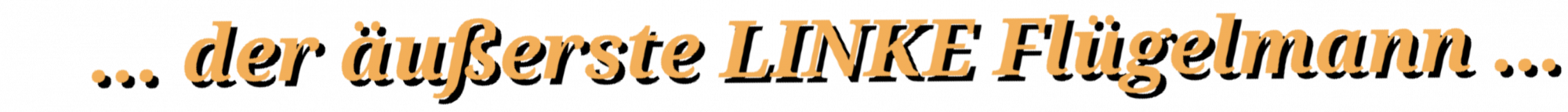

Kapitalismus ist der Parasit der Marktwirtschaft. Bei Gesell geht es im Wesen um die Regulierung von Monopolen, speziel den Natürlichen, wie Geld und Boden, man könnte auch Infrastruktur dazu nehmen.
Die Geldfrage ist die Wichtigste, denn der erzeugte Zins wandert in die Preise und erzwingt die Ausweitung der Geldmenge, als auch die Umverteilung von Unten nach Oben.
Im links dazu kostenlose Bücher.