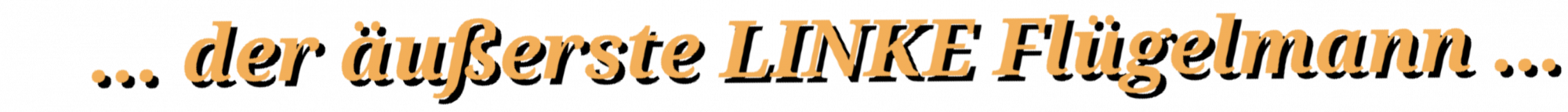Erklärung zur Aufklärung:
Der Zins – Eine ökonomische Selbstverständlichkeit oder ein systemischer Irrtum?
In der Wirtschaftswissenschaft gilt der Zins oft als unverzichtbares Instrument. Er soll Kapital (Geld) mobilisieren, Investitionen sinnvoll lenken, Inflation ausgleichen und Risiken absichern.
Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich:
Viele dieser Begründungen sind verkürzt, widersprüchlich oder sogar irreführend. Es lohnt sich, den Zins nicht als gegeben oder Naturgesetz hinzunehmen, sondern kritisch zu hinterfragen.
Der Zins – Etwas natürliches?
Obwohl Naturbilder wie „ein Baum, der Früchte trägt“ oder „eine Kuh, die Milch gibt“ oft zur Rechtfertigung von Zinsen herangezogen werden, handelt es sich dabei um Erträge aus aktiver Arbeit, Pflege und biologischer Entwicklung. Diese Prozesse setzen Zeit, Energie und Verantwortung voraus – sie sind also Arbeitserträge. Der klassische Zins hingegen entsteht nicht durch produktive Tätigkeit, sondern allein durch das Besitzrecht am knappen Kapital (z.B. Geld).
Die Verwendung solcher Naturvergleiche kann daher zu einer kategorischen Verwechslung führen:
Sie vermischen aktive Leistung mit passivem Besitz und verschleiern die ethische und ökonomische Kritik am Zins als leistungslosem Einkommen (ökonomische Rente).
Wein-Beispiel von Eugen Böhm-Bawerk:
Böhm-Bawerk argumentierte, dass Güter durch Zeit an Wert gewinnen können, und nutzte Wein als Beispiel:
Ein Fass Wein ist heute weniger wert als dasselbe Fass in zehn Jahren, wenn es gereift ist.
→ Daraus folgert er: Zeit hat ökonomischen Wert, und dieser Wertunterschied rechtfertigt den positiven Zins.
Dies ist Teil seiner Zeitpräferenztheorie, die besagt, dass Menschen gegenwärtige Güter höher bewerten als zukünftige – und deshalb bereit sind, für die sofortige Verfügbarkeit von Kapital einen Zins zu zahlen.
Warum das eine irrige Behauptung ist:
1. Wein gewinnt an Wert durch Reifung – nicht durch bloßes Liegen:
Der Wertzuwachs entsteht durch biochemische Prozesse, also eine Form von Arbeit der Natur. Es ist also kein passiver Kapitalertrag, sondern ein natürlicher Transformationsprozess. Die Natur arbeitet, was Ökonomen gerne mal übersehen!
2. Nicht alle Güter gewinnen durch Zeit an Wert:
Viele Güter verlieren mit der Zeit an Wert (z. B. Elektronik, Kleidung, Lebensmittel). Das Beispiel ist also nicht verallgemeinerbar. Somit ist der Reifeprozess des Weines oder auch bei Käse usw. ein selektives Beispiel, dass trotzdem nicht auf einen Zins bezogen werden kann.
3. Zins ist nicht identisch mit Wertsteigerung:
Der Zins ist ein Geldmechanismus, der unabhängig vom realen Wertzuwachs funktioniert. Ein Kredit kann Zinsen kosten, auch wenn das geliehene Geld keinen realen Mehrwert erzeugt. Dies und die Negativzinsphase belegt, dass positive Zinsen nicht notwendig sind.
Auch Silvio Gesell widerspricht in seinem Hauptwerk (Die natürliche Wirtschaftsordnung) der Behauptung von Böhm-Bawerk!
Gesell argumentiert, dass Geld durch seine Hortbarkeit künstlich bevorzugt und verknappt wird und deshalb Zins entsteht – nicht wegen Zeitpräferenz, sondern wegen Macht über den Tauschprozess. Geld kann warten, Waren und Arbeit nicht!
Kurze Gegenüberstellung: Ursache Zins durch Zeitpräferenz oder Knappheit?
Die Zeitpräferenz-Theorie besagt, dass Menschen gegenwärtigen Konsum gegenüber zukünftigem Konsum bevorzugen. Wer Geld verleiht, verzichtet auf sofortige Nutzung und erwartet dafür eine Entschädigung – den Zins. Diese Sicht ist psychologisch plausibel, aber sie setzt voraus, dass der Verzicht real ist, was selten zutrifft, da oft nur überschüssiges Kapital (Geld) verliehen wird. Zusätzlich wird die Bedarfssättigung der Menschen ignoriert und von einem unbegrenzten Bedarf ausgegangen, was aber eine wage Annahme ist.
Die Knappheitstheorie hingegen argumentiert, dass Zinsen entstehen, weil Kapital (z.B. Geld) ein knappes Gut ist oder künstlich verknappt wird. Wer Zugang zu Kapital (z.B. Geld) will, muss dafür zahlen. Diese Sichtweise ist stärker marktbezogen und erklärt Zinsen als Preis für den Verleih eines knappen Guts – unabhängig von individueller Zeitpräferenz.
Zum Einwand, dass Geld ja nicht knapp ist, weil es beliebig geschöpft werden kann: Diese Annahme beruht auf einen Trugschluss, denn nur weil Geld beliebig geschöpft werden kann, heißt es nicht, dass auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Außerdem werden auch bei der Geldschöpfung wieder Zinsen fällig. Das belegt, dass Geld künstlich verknappt wird. (Hier auch ein Hinweis auf Prof. Dieter Suhr, der das deutlich herausgearbeitet hat! https://dieter-suhr.info/de/Publikationen/buecher.html)
Knappheit ist also die realere und systemische Ursache für Zins als die oft behauptete Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenz-Theorie ist modellhaft und ideologisch geprägt, während die Knappheitslogik ökonomisch und sozial fundierter ist.
Wie wird der Zins weiter begründet?
A) Zins als Entgelt für Konsumverzicht?
Ein oft genannter Grund für Zinsen ist der angebliche „Verzicht auf Konsum“ durch den Kapitalgeber. Doch wer Geld verleiht, tut dies in der Regel nicht aus Verzicht, sondern weil er einen Überschuss hat. (Menschen ohne Geld werden nie Geld gegen Zins verleihen können! Nur Menschen mit Geld können dies machen!) Es handelt sich also nicht um eine Leistung, sondern um die (Aus-)Nutzung von Besitz. Die Vorstellung, Zinsen seien eine Art Belohnung für Enthaltsamkeit, ist theoretisch konstruiert, aber empirisch nicht haltbar. Sie beruht also nur auf einer unbelegten Annahme.
B) Zins als Anreiz zum Sparen?
Auch die Behauptung, Zinsen würden Menschen zum Sparen motivieren, greift zu kurz. Die meisten Menschen sparen aus Vorsorgegründen – für Notfälle, das Alter oder größere Anschaffungen. Der Zins ist dabei höchstens ein Bonus, nicht der Hauptgrund. In Zeiten niedriger oder negativer Zinsen zeigt sich: Menschen sparen trotzdem – weil Sicherheit und Zukunftsplanung wichtiger sind als Rendite.
C) Zins und Inflation – ein selbstverstärkendes System?
Zinsen sollen laut Lehrbuch die Inflation ausgleichen. Doch in der Praxis tragen sie selbst zur Inflation bei: Unternehmen und Staaten müssen Zinskosten decken – durch Preiserhöhungen oder höhere Steuerlasten. Das führt zu einem Kreislauf, in dem Zins und Inflation sich gegenseitig verstärken. Der „Inflationsausgleich“ ist also kein neutraler Mechanismus, sondern Teil eines systemischen Problems.
D) Zins und Verteilungsgerechtigkeit – ein Mythos?
Manche Ökonomen behaupten, Zinsen würden Kapital (Geld) dorthin lenken, wo es produktiv eingesetzt wird. Doch Kapital (Geld) folgt der höchsten Rendite, nicht dem höchsten gesellschaftlichen Nutzen. Das führt zu Spekulation, Immobilienblasen und sozialer Ungleichheit, sowie letztendlich zu Krisen. In ärmeren Ländern blockieren hohe Zinsen den Zugang zu Krediten – und damit zu Bildung, Gesundheit und Entwicklung.
E) Zins und Fehlallokation?
Zinsen sollen angeblich verhindern, dass Kapital in unsinnige Projekte fließt. Doch gerade hochverzinste Anlagen sind oft unproduktiv oder spekulativ – etwa Derivate, Kryptowährungen oder überbewertete Immobilien. Der Zins fördert also auch Fehlallokationen, statt sie zu verhindern. Er ist in diesem Punkt ein zweischneidiges Schwert.
Silvio Gesell – eine Alternative für ein neues Zinssystem:
Der Sozialreformer Silvio Gesell kritisierte den Zins als leistungslose Einnahme (ökonomische Rente), die zu Ungleichheit und Wachstumszwang führt. Gesell sieht den Ursprung des Zinses in dem Horten von Geld und der damit verbundenen Knappheit. Seine Idee des „Freigeldes“, das durch Umlaufsicherung (Geldhaltegebühr) an nominellen Wert verliert, bietet eine systemische Alternative. Geld soll zirkulieren, nicht gehortet werden. Gesells Ansatz ist säkular, universell und ökonomisch fundiert – und verdient somit mehr Aufmerksamkeit.
Fazit: Zins – Wissenschaft oder Dogma?
Wenn Ökonomen diese Zusammenhänge leugnen oder ignorieren, stellt sich die Frage: Handeln sie noch wissenschaftlich – oder verteidigen sie ein System, das sie nicht hinterfragen wollen? Echte Wissenschaft lebt von Kritik, Offenheit und der Bereitschaft, auch unbequeme Wahrheiten zu erkennen. Der Zins ist kein Naturgesetz – sondern ein menschlich gemachtes Instrument, das dringend neu gedacht werden muss.