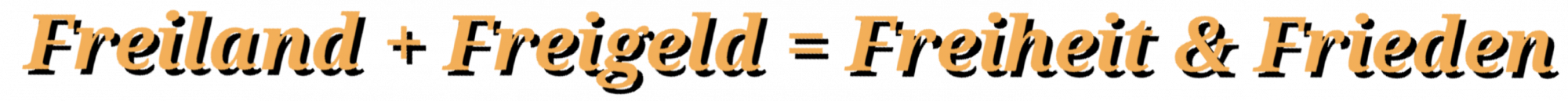Immer wieder wird der Volksrepublik der Vorwurf gemacht, durch staatliche Subventionen unlauteren Wettbewerb zu fördern und die Konkurrenzfähigkeit westlicher Unternehmen zu untergraben. Dabei hat der politische Westen maßgeblich zu dieser Situation mit beigetragen.
Alte Erfolge
Der vergangene Fünf-Jahr-Plan für die Jahre 2021 bis 2025 stand in der Volksrepublik unter dem Leitgedanken der Strategie „Made in China 2025“. Die chinesische Wirtschaft sollte zu einer Industriemacht weiter entwickelt werden. Anerkennung beziehungsweise Aufwertung ihrer Produkte auf dem Weltmarkt wurden angestrebt. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hatte die Forderung aufgestellt: “Wir müssen international wettbewerbsfähige Unternehmen schaffen.”(1)
“Made in China 2025” definierte Branchen wie Automatisierung- und Umwelttechnik, Automobile, Luftfahrt und Informationstechnologie, in denen die chinesische Wirtschaft kräftig zulegen sollte. Dabei ging es um die Ausweitung der Produktionskapazitäten und eine bessere Stellung chinesischer Produkte nicht nur auf dem Weltmarkt sondern auch auf dem heimischen: Huawei-Handys statt i-phone, chinesische Elekroautos statt TEsla. Chinesische Waren sollten den westlichen gleichkommen in Ansehen, Qualität und Nachfrage.
Zum Erreichen dieses Ziels gehörte auch die Übernahme hoch entwickelter Unternehmen im Westen. Man wollte deren Technologie erwerben, aber auch deren Markennamen, weil sie international hohes Ansehen genossen. Denn “die Chinesen haben immer das Problem gehabt, dass sie sehr schwache Marken haben, die sie nicht globalisieren können”(2). Nach der Weltwirtschaftskrise von 2007/8 war Peking im Westen auf Einkaufstour gegangen.
Statt ihre Rücklagen in US-Anleihen zu investieren, die sich gerade in der Krise als nicht sehr zuverlässig gezeigt hatten, übernahmen Chinesen renommierte Autofirmen wie MG, Volvo, Lotus, Borgward oder sonstige High-Tech-Unternehmen wie den deutschen Roboterhersteller Kuka, den Betonpumpenspezialisten Putzmeister und viele andere, die zu den Zielen der Führung in Peking passten. Im Jahr 2015 hatte China allein in Deutschland 179 Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie übernommen. Es waren sehr häufig staatliche Unternehmen, die als Käufer auftraten.
Als im Jahr 2017 die chinesischen Übernahmen in Deutschland mit über 12 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreicht hatten, schränkte die Bundesregierung die Käufe chinesischer Interessenten ein. Meinungsmacher aus Medien, Politik und Wissenschaft hatten Ängste geschürt vor einem Ausverkauf deutscher Technologie, Arbeitsplätze und Sicherheit. Der Wirtschaft selbst waren die chinesischen Investoren willkommen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Verlauf des 14. Fünfjahr-Plans ein starker Anstieg der chinesischen Industrieproduktion durch Ausweitung der eigenen Kapazitäten als auch durch Zukäufe im Ausland eingetreten war.
Die Volksrepublik errang in einigen Industriebereichen eine weltweite Spitzenstellung wie in der Schiffsproduktion und Eisenbahntechnik, der Photovoltaik, Elektrofahrzeugen und deren Batterien sowie Computertechnologie und IT-Ausrüstung. Der wirtschaftliche Erfolg lässt sich ablesen an den Staatseinnahmen aus Steuern und Gebühren, die in der Zeit von 2021 bis 2025 etwa 155 Billionen Yuan (21.600 Milliarden Dollar) ausmachten. Das sind 80 Prozent der gesamten Staatseinnahmen, obwohl es im gleichen Zeitraum Steuersenkungen in Höhe von zehn Billionen Yuan gegeben hatte.(3)
Neue Herausforderungen
Dass die chinesische Wirtschaft so stark gewachsen war, war Ergebnis konkurrenzfähiger Produktionsanlagen. Chinas Exporte wuchsen, weil der Weltmarkt die Produkte aufnahm, und der Weltmarkt wuchs, weil immer mehr chinesische Produkte zu sinkenden Preisen angeboten wurden. Diese Entwicklung war besonders bei der Photovoltaik auch im westlichen Alltag erkennbar.
Chinas steigende Exporte führten schon bald zu Handelsbilanzüberschüssen mit vielen Industrienationen. Im Jahr 2017, dem Beginn ersten Amtszeit von Donald Trump, betrug das Defizit der USA im Handel mit China 375 Milliarden Dollar. Das hatte der neue Präsident durch Zölle auf chinesische Waren abbauen wollen. Zudem sollte die Konkurrenzsituation für US-Unternehmen besser werden, um wieder mehr Wirtschaftstätigkeit und Arbeitsplätze in die USA zurück zu holen.
Insgesamt belegte Trump chinesische Waren in Höhe von 360 Milliarden Dollar mit Zöllen von bis zu 25 Prozent. Chinas Ausfuhren in die USA sanken um rund 37 Prozent. Diese Zölle wurden auch unter der Regierung von US-Präsident Biden nicht zurück genommen, teilweise sogar noch ausgeweitet. Bald nach Trumps ersten Zollanhebungen hatte auch die Europäische Union die Importe chinesischer Waren durch sogenannte Anti-Dumping-Zölle und ähnliche Maßnahmen eingeschränkt.
All diese Behinderungen durch den politischen Westens blieben natürlich nicht ohne Auswirkungen auf den Absatz chinesischer Unternehmen. Darunter litt die Auslastung ihrer Produktionsanlagen, die ja auf eine höhere Nachfrage des Weltmarktes und damit auch auf einen höheren Export ausgelegt waren. Daran wird deutlich, dass die vom politischen Westen immer wieder beklagten Überkapazitäten nicht Ergebnis übermäßiger staatlicher Förderung durch China sind.
Vielmehr ist staatliches Einschreiten vonseiten westlicher Regierungen in Form von Importbeschränkungen durch die USA und die EU dafür verantwortlich. Man kann aber von Peking nicht erwarten, dass sie die eigenen Unternehmen nicht schützt und Schädigungen durch Maßnahmen anderer Regierungen tatenlos zusieht. Dennoch ist festzustellen, dass die chinesische Führung eher zu Verhandlungslösungen neigte als zur Verhängung von Gegenzöllen.
Im Zuge von Corona erlitt der Welthandel durch die strengen Produktionseinschränkungen in China erhebliche Einbußen. Den Industriestaaten des Westens wurde plötzlich bewusst, wie stark sie auf Lieferungen aus der Volksrepublik angewiesen waren, die sie bisher zunehmend behindert hatten. In der Folge versuchten sie, ihre Lieferketten unter Umgehung Chinas neu zu organisieren. Teilweise gelang es westlichen Unternehmen, auf Indien und Vietnam auszuweichen.
Neue Verhältnisse
All diese Entwicklungen hatten Einfluss auf die Auslastung der Produktionskapazitäten in China. Dass diese in der Folge das Aufnahmevermögen des Weltmarktes überstiegen, liegt zum einen daran, dass sich dessen Volumen und Struktur durch die protektionistischen Maßnahmen der USA und der EU verändert hatten. Es liegt aber auch daran, dass ja nicht nur China für den Weltmarkt produziert. Auch die westlichen Staaten bauen ihre Kapazitäten aus, um den Chinesen auf dem Weltmarkt Konkurrenz zu machen.
Darüber verlieren die Kritiker Chinas aber kaum ein Wort. Sie scheinen weiterhin verfangen in der Vorstellung, dass alle anderen Nationen sich den westlichen Interessen unterzuordnen haben. In Förderprogramme in den USA unter Biden (Chips-Act, Inflation Reaktion Act) und auch in der EU (Digitales Europa, Invest EU, EFRE), flossen Hunderten Milliarden. Sie führen zu einer zusätzlichen Ausweitung von Produktionskapazitäten mit dem Ziel, die technologische Entwicklung im eigenen Wirtschaftsraum zu fördern und die Vorherrschaft Chinas auf dem Weltmarkt einzudämmen.
Darüber hinaus verfügen viele westliche Unternehmen, die bekanntesten darunter apple und Tesla, selbst über eigene Produktionsstätten in der Volksrepublik und beliefern von dort aus den Weltmarkt. Die Im- und Exporte ausländischer Unternehmen beliefen sich nach den neusten Zolldaten allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres auf 7,46 Billionen Yuan(etwa 1.000 Milliarden Dollar), ein Plus von 2,6 Prozent. „Sie machten 29 Prozent des gesamten chinesischen Außenhandels“(4) aus.
Die Einschränkungen des Imports chinesischer Waren in den USA und der EU haben zu einem Absinken der Herstellerpreise in China und der Verbraucherpreise auf den Weltmärkten geführt. Für die Menschen im Westen war das sehr deutlich an den Preisen für Solaranlagen nachzuverfolgen. Diese verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren Preisrückgänge von etwa 80 Prozent bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit der Module (5).
Diese Entwicklung der Preise nicht nur bei den Solarmodulen machten chinesische Produkte einem breiteren Publikum sowohl in den wohlhabenden, besonders jedoch in den Entwicklungsländern zugänglich. Gleichzeitig führten sie aber auch zu einer erhöhten Konkurrenz unter den Herstellern und zu sinkenden Gewinnen in China. So meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung Anfang dieses Jahres über dessen Wirtschaftsentwicklung: „Im vergangenen Jahr[2024] legte der Verbraucherpreisindex nur um 0,2 Prozent zu [, und] die Erzeugerpreise sind seit zweieinhalb Jahren negativ“ (6).
Neue Politik
Diese Zahlen sind natürlich auch der Führung in Peking bekannt. Sie weiß um den Verfall der Preise und vor allem um den Verfall der Ertragskraft, wenn auch die Umsätze und Exporte der chinesischen Wirtschaft immer noch weiter wachsen. Besonders der Export in die Länder des sogenannten Globalen Südens steigt aufgrund der sinkenden Preise, auch in die Asean-Region und vor allem in die Staaten entlang der Seidenstraße(7). Deren Länder werden immer mehr zum Investitionsziel, während sie in den Anfangszeiten eher nur eine Transitstrecke für chinesische Produkte waren.
Trotzdem lässt sich die Pekinger Führung durch diese Zahlen nicht über die Gefahren täuschen, die von einer wachsenden Preiskonkurrenz unter den chinesischen Unternehmen selbst ausgehen. Nicht nur die Wirtschaft, auch Banken, die diese Konkurrenz finanzieren, könnten in Schwierigkeiten geraten. So „sanken die Gewinne mittlerer und großer Industrieunternehmen im Mai im Jahresvergleich um 9,1 Prozent“(8) Deshalb warnt Peking vor Billigexporten zu Preisen unter den Herstellungskosten und vor „unfairen Wettbewerb“.
Noch appelliert man nur an die Unternehmen und Verbände, „Marktdisziplin“ einzuhalten, und fordert sie zur Entwicklung eines eigenen Verhaltenskodex auf. Gleichzeitig aber weist das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) auch darauf hin, „dass es der Kapazitätssteuerung in Sektoren wie Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und Photovoltaik Priorität einräumen wird“. (9) Man will unkontrollierten und ruinösen Wettbewerb verhindern. Die Führung warnt ausdrücklich vor der Einschränkung von Sicherheit und Qualität der Produkte zugunsten der Konkurrenzfähigkeit. Man wird Maßnahmen ergreifen, wenn die Wirtschaft selbst nicht in der Lage ist, das Problem zufriedenstellend zu lösen.
Um die Ertragslage der Unternehmen kurzfristig zu verbessern, hat die Regierung kurzfristig den privaten Konsum angeregt, der trotz hoher Sparguthaben der Chinesen immer noch weit unter dem der OECD-Staaten liegt. Sie fördert mit Zuschüssen den Kauf neuer elektrischer Haushaltsgeräte gegen die Entsorgung älterer. Langfristig aber soll Massenproduktion unter sinkenden Erlösen ersetzt werden durch eine Produktion mit höherer Wertschöpfung. Unter dem Begriff „qualitativ hochwertige Entwicklung“ werden Investitionen in die Hightech-Fertigung und strategisch wichtige Wachstumsbranchen bevorzugt gefördert. Ziel ist die „Verwirklichung der sozialistischen Modernisierung“(10).
(1) Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 12.6.2016 “Target” Deutschland
(2) ebenda
(5) Quelle: https://echtsolar.de/preisentwicklung-solarmodule/#tve-jump-195b069c8ac
(6) FAZ vom 18.1.2025: Wachstum wie gewünscht
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den BlogPolitische Analyse.