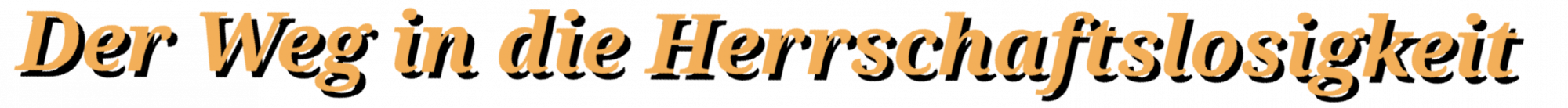Weiterleitung eines Newsletters von Roland Moesl
Da gibt es den Begriff der Volllaststunden. Wird eine Stromleitung 4.380 Stunden pro Jahr mit 100% Last und 4380 Stunden pro Jahr mit 50% Last betrieben, dann wären dies 6.570 Volllaststunden. Photovoltaik in Mitteleuropa hat um die 1.000 Volllaststunden pro Jahr. Wenn der größte Teil neuer Anlagen zur Stromerzeugung so wenig Volllaststunden haben, dann ist es völlig logisch, dass die Transportkosten für den Strom zunehmen. Diese nennt man Netzgebühren.
Im Jahr 2024 habe ich 2.571 kWh zu Hause verbraucht. Davon war nur 152 € der Arbeitspreis vom Strom. Der Rest von den bezahlten 528 € verteilt sich auf Handlinggebühr und Grundgebühr von SpottyEnergie.at und den ganz großen Hammer Netzgebühren. 2025 gibt es noch höhere Netzgebühren. Also zahle ich fast doppelt so viel Netzgebühren gegenüber dem reinen Arbeitspreis vom Strom. Da ist wie im Versandhandel: Ware um 15 € einkaufen, zur Kasse gehen, und da kommen auf einmal 30 € Versandkosten dazu.
Die Netzausbaukosten sind keine Kleinigkeit, diese sind für den größten Teil des Strompreises bestimmend. Dieser ist wieder entscheidend, wie schnell der Umstieg auf Elektroautos erfolgt. Da steht der Preis von 3 kWh Strom gegen einen Liter Diesel. Aber es geht auch deutlich schlimmer, bei einem Zementwerk wie der LEUBE stehen 260 GWh/a Strom gegen 400 GWh/a thermische Energie gegenüber, wenn man von Verbrennung auf Klinker mit Strom erhitzen umstellen würde.
| Die destruktive „Koste es, was es wolle“ Mentalität |
Die Energiewendefans fühlen sich als Retter der Menschheit, welche über den dummen Rest der Menschheit nach Belieben bestimmen können. Es ist nötig, wir müssen es so tun, koste es, was es wolle. Nichts zerstört das Kostenbewusstsein mehr, als zu Denken, einer Weltretter-Elite anzugehören. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen Flatterstrom, 24-Strom und 365/24-Strom.
Da ergehen sich die Fanboys der Energiewende in endlosen Jubel, wie billig Flatterstrom doch sei. Um Flatterstrom zu 24-Strom zu veredeln, sind 3 kWh Akkus pro kW Photovoltaik erforderlich. Die weitere Veredelung zu 365/24-Strom erfordert auch die Umwandlung in chemische Energie, Lagerung und Rückverstromung. Der Aufwand dafür ist je nach Breitengrad sehr unterschiedlich.
Aber die Fanboys der Energiewende führen ihren euphorischen Triumphtanz auf „Flatterstrom ist billiger als Strom vom Gaskraftwerk“. Der ganze Rest? Die Veredelung zu 365/24 und den Transport zum Verbraucher? Unwichtig, das wird schon irgendwie gelöst werden, koste es, was es wolle.
| 5 Hektar als Beispiel |
Ich schreibe gerade einen neuen Roman, er heißt „Antrag Basisförderung Forschungsförderungsgesellschaft“. Da schrieb ich über das Potenzial der Kostenoptimierung beim Netzausbau:
5 Hektar Photovoltaik-Freifeldanlage mit 6 MW Photovoltaik, aber ohne Speicher, erfordern 6 MW Netzanschluss.
5 Hektar energieoptimierte Siedlung haben auch 6 MW Photovoltaik, aber auch 18 MWh Natrium-Akkus. Deswegen ist ein 2 MW Netzanschluss bereits ausreichend.
Mit einer lokalen Power to Methanolanlage ist eine weitere Optimierung möglich: Da würden die 18 MWh Natrium-Akkus noch mit 1 MW Power to Methanol ergänzt werden. Der erforderliche Netzanschluss sinkt auf 0,75 MW. Ein MW Power to Methanol erzeugt rund 100 Liter pro Stunde. Wir hier haben schon ein gut ausgebautes Hochspannungsnetzwerk. Da ist der Unterschied im Wirkungsgrad zwischen einem 500-kW-Generator und einem 500 MW GuD Kraftwerk entscheidend. Deswegen wird dieses Methanol mit selbstfahrenden Elektro-LKW zu zentralen GuD Kraftwerken gefahren. Bei den 5 ha wären dies etwa 250.000 Liter Methanol, 12 Fahrten pro Jahr mit einem großen LKW.
Welche Variante ist billiger? Mit dieser Frage sollten sich eigentlich eine Menge Forschungsinstitute auseinandersetzen.
| Beispiel für eine mögliche Regelung |
Hurra, ich habe 6 MW Photovoltaik, ich zahle nur die Kosten bis zum Netzanschlusspunkt, der Netzbetreiber muss laut EEG den Rest bezahlen. Der Netzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, das Netz entsprechend auszubauen. Die Kosten landen dann in explodierenden Netzgebühren.
Dies sollte sofort reduziert werden auf, der Netzbetreiber übernimmt die Ausbaukosten für einen 2 MW Netzanschluss. Richtig, nicht 6 MW sondern 2 MW. Das reicht aus, wenn die 6 MW Photovoltaik mit 18 MWh Akkus ergänzt werden. Unter der Annahme, dass dezentrales Power to Methanol kosteneffizienter ist als zentrale Großtechnik, könnte dies später noch weiter reduziert werden: zwischen 200 und 400 GW Photovoltaikausbau in Deutschland wird der für den Netzbetreiber verpflichtende Netzausbau bei diesem 6 MW peak Photovoltaik Beispiel von 2 MW auf 0,75 MW gesenkt. Bei einer linearen Absenkung wären dann bei 300 GW Photovoltaik 1,375 MW Netzanschluss im 6 MW peak Beispiel vom Netzbetreiber zu errichten.
| 10.000 km² in Deutschland 1.000 km² in Österreich |
Das wären die in der Broschüre Politik und Philosophie genannten Ausbauziele für energieoptimierte Siedlungsgebiete. Bei oben genannten Zahlen wäre dies 400 GW in Deutschland und 40 GW in Österreich an Stromanschluss, dies kann deutlich auf 250 GW, 25 GW nach unten korrigiert werden. Bei der Variante dezentrales Power to wären es 150 oder 15 GW.